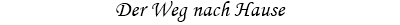|
© 2005
Mühsam stapft der alte Mann durch den Schnee. Es ist nur ein schmaler Pfad, der hinaufführt. Immer wieder verheddert sich die große Decke, die er sich gegen die eisige Kälte um die Schultern gelegt hat, im Geäst. Er ignoriert es und geht weiter. Sein langes Haar flattert im Wind um das faltige Gesicht, und eisige Kälte frisst sich immer penetranter durch seine Kleider. All das ist ihm gleichgültig. Er ist aus der Stadt gegangen, in der er so viele Jahre verbracht hat, sich bemühte glücklich zu sein und – ja, auch das – sogar manch frohere Stunde erleben durfte. Doch bei aller Herzlichkeit der Menschen, die ihn aufgenommen haben, als gehöre er zu ihrer Familie: Nie hat er wirklich dazugehört. Nicht zu diesen Leuten, geschweige denn zu den anderen.
Der alte Mann hat vieles erlebt und vieles gesehen. Und als er damals, '76, mit dem großen Führer nach jener Schlacht, jenem letzten großen Sieg, nach Kanada gegangen war, da glaubte er nach so langen Jahren des Kämpfens, der Verfolgungen und des Entbehrens, endlich Frieden zu finden. Doch auch das war ein Irrtum. Eines Tages waren sie wieder gekommen, diese Männer, und einer, der in ihren Diensten stand, erschoss den großen Führer. Als er die Anhöhe erreicht, auf der zwei Bäume so dicht nebeneinanderstehen, dass ihre Äste einander berühren, wie an diesem magischen Ort die Vergangenheit und die Zukunft ineinander überzutreten scheinen, hält der Mann einen Augenblick inne. Auf seine Lanze gestützt, die ihm schon längst eher ein Stock denn eine Waffe ist, atmet er durch, und die eisige Luft schmerzt in seinen Lungen. Sein Sohn liegt hier beerdigt. Von hier aus kann er auch in das Tal hinunter sehen, in dem sich der Fluss daherwindet, heute noch genauso wie damals. Doch heute sieht er nicht mehr die gewaltigen Büffelherden, die einst dort grasten. Statt dessen erblickt er die Stadt, die in den letzten Jahren ständig größer geworden ist. Die Stadt, in der er endlich zur Ruhe gekommen war. Die Stadt, in der seine Freunde leben, die doch so anders sind als er. Der kleine Timmy, der zwölfjährige Sohn der Familie, hat ihn oft an seinen eigenen Sohn erinnert. Doch dieser durfte nicht den dreizehnten Sommer seines Lebens erfahren. Dafür hatten die Langmesser schon gesorgt. Einen Augenblick lang verzerrt sich das Gesicht des Alten vor Schmerz und Wut. Aber die Vergangenheit ist vorüber, und der Morgen naht. Unaufhaltsam. Unabänderlich. Später, als er die Augen öffnet, erhebt er sich mit neuer Kraft. Die Kälte ist vorüber, der Himmel erstrahlt in tiefem Blau, das Gras unter seinen Füßen ist grün und saftig, und er geht mit sicherem Schritt ins Tal hinunter. Die Büffel sind zurückgekehrt. Am Abend des Tages kommt Martin Carnes auf die Lichtung. Den ganzen Tag über ist er schon auf der Suche nach seinem Freund, dem Mann, der seinem Vater einst das Leben rettete. Er glaubt zwar nicht, dass er den alten Indianer hier findet – immerhin ist der Weg von der Stadt herauf für einen 101-jährigen Mann doch recht mühsam –, aber im Haus und in der Stadt hat er vergeblich gesucht. Als er die Lanze des Indianers erblickt, macht sein Herz einen Sprung, und er weiß, dass er ihn gefunden hat. E N D E | |
| Diese Seite wurde zuletzt am aktualisiert. Copyright © Patrick Schön. Alle Rechte vorbehalten. | |
| Impressum / Datenschutz | nach oben |